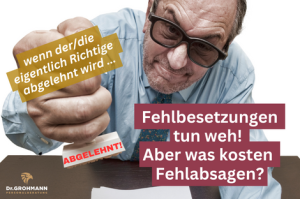Kann man sich ein „nicht soziales“ Verkaufen vorstellen? Nein – Verkaufen ist immer sozial, weil es immer ein Austausch zwischen Individuen oder Gruppen ist. Selbst dann, wenn die Menschheit sich zu Mensch-Maschine-Cyborgs entwickelt haben sollte oder wenn nur noch Avatare kaufen und verkaufen, bleibt der Vertrieb ein sich im sozialen Raum vollziehender Vorgang. Unbestritten ist, dass der Begriffsinhalt von „Social Selling“, also das Konzept dahinter, etwas Neues und substanziell Bemerkenswertes bezeichnet. Es ist durchaus notwendig und hilfreich, hierfür einen eigenen Begriff zu verwenden. Aber bitte nicht „Soziales Verkaufen“ oder „Social Selling“!
„Social Selling“ ist als Bezeichnung der betreffenden Verkaufsform völlig ungeeignet
Wenn alles Verkaufen sozial ist, warum soll dann ausgerechnet das Verkaufen in digitalen sozialen Netzwerken als „social“ bezeichnet werden? Das würde logisch nur dann Sinn machen, wenn das Verkaufen außerhalb sozialer Netzwerke nicht mehr sozial oder zumindest sehr viel weniger sozial wäre. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall! Das Besondere am sogenannten „Social Selling“ ist ja schließlich, dass Verkaufskommunikation zunächst rein online stattfindet und eben nicht im direkten persönlichen Austausch. Die Bezeichnung „Social Selling“ drückt also genau das Gegenteil dessen aus, was er inhaltlich sinnvoller Weise bedeutet. Der Begriff ist also denkbar ungeeignet. Man sollte stattdessen besser Begriffe wie „digitales Verkaufen“ oder „Remote Selling“ verwenden.
Ich vermute, dass zu Beginn der professionellen digitalen Netzwerke und mit der einhergehenden Erfindung zugehöriger Vertriebskonzepte hierfür Begriffe wie „Social Media Selling“ oder „Social Network Selling“ benutzt wurden. Man hat dann irgendwann – aus Gedankenlosigkeit oder vielleicht weil das besser klingt – den mittleren Teil weggelassen. Schließlich musste das Konzept als Vertriebstool, Dienstleistung oder Training vermarktet werden und in dem Zusammenhang hat sich ein eingängiger, einfacher und griffiger Produktname eingebürgert.
- Wie kommt es, dass Begriffe wie „Social Selling“, die bei genauer Betrachtung schlichtweg falsch sind, eine so erfolgreiche Verbreitung finden?
- Wie kommt es, dass wir so einen Begriff unreflektiert verwenden und gar nicht bemerken, dass sich im Sprachgebrauch eine sachlogische Fehlbezeichnung eingeschlichen hat?
- Wie verhält es sich generell mit den Anglizismen im Geschäftsleben? Ist hiermit ein besonders großes Einfallstor für Bedeutungsverdrehungen gegeben?
Vernebelte Begriffe führen zu vernebeltem Denken und vernebelter Kommunikation
Begriffe sind dazu da, einen Gegenstand zutreffend zu bezeichnen und trennscharf gegenüber anderen Begriffen abzugrenzen. Wenn man dieses „normative Ideal“ aufgibt, kann man gleich mit Sachlogik und vernünftiger Kommunikation aufhören. Der Anspruch muss prinzipielle Geltung haben, auch wenn die gesellschaftliche Realität völlig anders aussieht: Im Bereich der Werbung, der Medien und der Politik werden Heerscharen von findigen Wort- und Textkünstlern professionell damit beauftragt, zu framen und zu labeln, Problemkonstellationen und Narrative zu kreieren und bedeutungsmäßig zu etablieren. Das ist schließlich ihr Job als Journalisten, Werbetexter und Content-Manager im gesellschaftlichen Kampf um die Deutungshoheit. Es geht hierbei natürlich nicht um differenzierte Wahrnehmung, Tatsachenfeststellung und sachlogische Aufklärung sondern darum, eine spontane Verhaltensbeeinflussung zu erreichen ohne, dass der Betroffene lange darüber nachdenkt. Zu diesem Zweck bieten Anglizismen und insbesondere das sogenannte „Denglisch“ die besten Gestaltungsmöglichkeiten. Warum?
- Insbesondere durch Denglisch bietet sich die Möglichkeit, neue Worte zu kreieren und diese ganz beliebig, je nach Marktlage, mit Bedeutungen zu befüllen. Mit der Kreation wird gleichsam ein Expertenstatus festgeschrieben. Ganze Berater-Kohorten leben hiervon.
- Sie verführen zur unreflektierten Adaption. Weil man auf den ersten Blick nicht erkennt, was der jeweilige Begriff bedeuten soll, muss man sich immer erst kundig machen, was der Begriffsinhalt eigentlich bedeutet. Hiermit übergibt man die eigene Definitionsmacht gedankenlos an Experten, erhält dafür wenigstens das gute Gefühl dazuzugehören.
- In der Wirtschaft sind Anglizismen in Mode und unangefochtener Ausdruck von Modernität, Kompetenz und Internationalität. Sie haben auf die Mehrheit eine unglaubliche geradezu irrationale Anziehungs- und Strahlkraft, sodass im Marketing gar nicht darauf verzichtet werden kann.

Es lebe der Anglizismus und der Denglizismus! Aber bitte mit Inhalt, Hirn und Verstand
Gegen den Gebrauch von Begriffen aus dem Englischen ist ja an sich nichts zu sagen. Sehr sinnvoll ist das beispielsweise im Fall, dass es z.B. für ein Phänomen gar keinen passenden deutschen Begriff gibt oder dieser nur umständlich auf Deutsch zu formulieren wäre. Lustiger Weise sind viele Anglizismen gar keine „Neophyten“ die aus dem englischsprachigen Raum eingewandert sind, sondern sogenannte „Scheinanglizismen“. Das ist dann eben Denglisch. Denglische Begriffe wurden im deutschsprachigen Raum kreiert – Englisch made in Germany – und bezeichnen oftmals Inhalte, die kein Amerikaner oder Engländer versteht. Handy, Home Office, Public Viewing und Mobbing sind wohl die bekanntesten dieser teutonischen Wortschöpfungen aus englischen Wortschnipseln. Und mit „Shit Storm“ assoziiert der gemeine Angelsachse wohl eher die Explosion der ortsnahen Kläranlage, als eine Überschüttung mit kritischen Beiträgen in den Sozialen Medien. Ist diese Lust an der Verdrehung und der Eigenkreation denglischer Bedeutungsinhalte späte teutonische Racheakte an unseren kulturellen „Kolonialherren“ für deren jahrzehntelange Überschwemmung mit dem „Amercian way of life“? Who knows?

Dem Phänomen kommt man nur mit Humor bei. Darum meine Bitte: Wenn Ihnen aus dem Geschäftsleben (Office Talk) besonders skurile oder lustige Angli- und Denglizismen begegnet sind, dann bitte im Kommentar kurz schildern oder mir über grohmann@grohmannexecutive.com mitteilen. Ich sammle das dann und poste bei Gelegenheit die Ergebnisse, quasi als Hitliste der denglischen Kuriositäten.
Vielen Dank
Ihr Romano Grohmann
Hier noch ein Link zu einer künstlerische Bearbeitung des Themas:
Alle Rechte beim Autor – Dr. Romano Grohmann©
Haben Sie Anregungen, Fragen oder Kritikpunkte?
Oder benötigen Sie Unterstützung in der Personalauswahl oder bei einer Stellenbesetzung?
Einfach mit dem menü unten mit mir in Kontakt treten. Ich antworte Ihnen in Kürze.